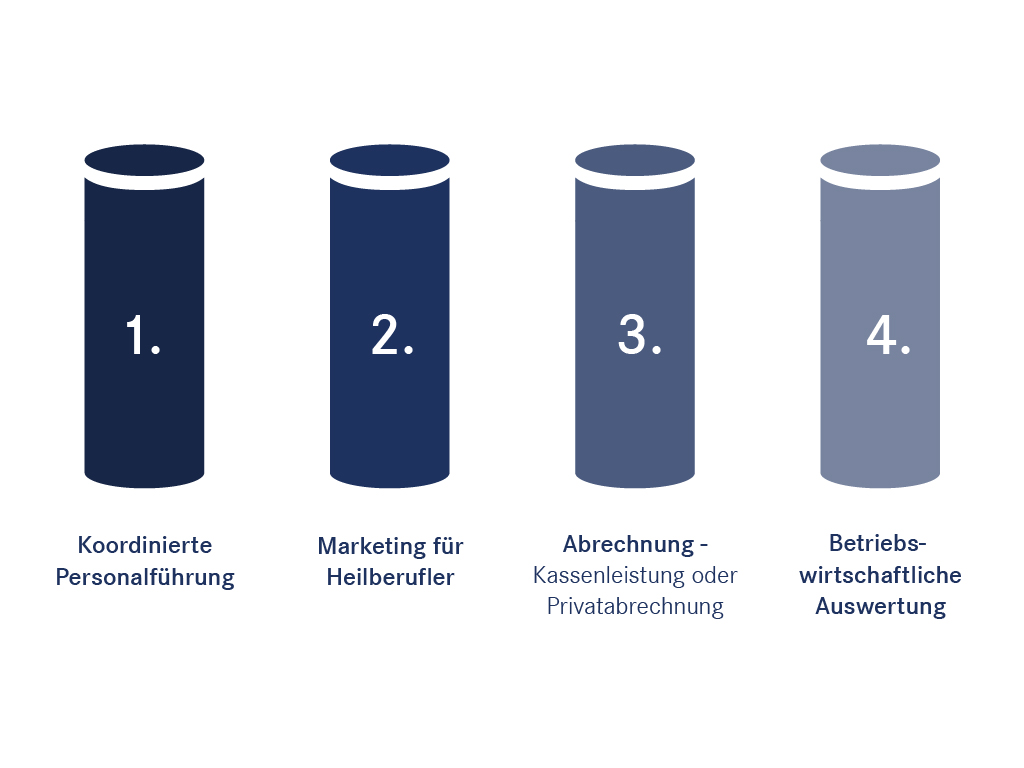In einer
Teilberufsausübungsgemeinschaft werden
einzelne ärztliche Leistungen von mehreren Ärzten gemeinsam erbracht, um Patienten mit bestimmten Krank
heits
bildern bes
ser betreuen zu können.
Die Teil-BAG ist typischer
weise über
örtlich und
bietet sich ins
beson
dere an, wenn bestimmte Krankheits
bilder
fachübergreifend mit Kollegen behandelt und nur einzelne Patienten gemein
sam versorgt werden. Die Partner behalten also ihren
eigenen Praxissitz bei, praktizieren daneben aber auch an dem Standort des Partners.
- Beispiel:
Denkbar wäre etwa, dass ein Kinderarzt und ein Orthopäde gemeinsam an einem Wochentag eine Sprechstunde anbieten. An den übrigen Tagen versorgt jeder Arzt seine Patienten unabhängig vom Partner.
Eine Teil-BAG ist sowohl innerhalb einer KV als auch KV-übergreifend erlaubt. Eine Genehmigung durch den Zulassungsausschuss der KV ist allerdings erforderlich.
Wichtig:
Die Teil-BAG darf nicht der Umgebung des Zuweisungsverbots gegen Entgelt dienen. Sowohl das Sozialrecht als auch die Berufsordnungen der Landesärztekammern untersagen in diesem Rahmen die Konstruktion von Kick-Back- bzw. Provisionsmodellen.